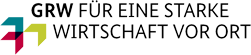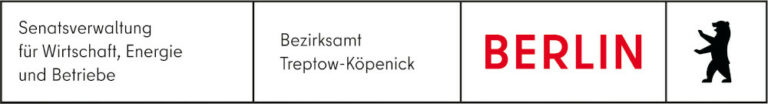Das Schönste an der Wuhlheide ist die Natur, die durch verschiedene Landschaftstypen geprägt ist. Große naturnahe Waldgebiete wechseln sich mit Wiesenflächen und gärtnerisch geprägten Freiflächen ab. Das eröffnet Besuchern viele Möglichkeiten. Sie können hier nach Lust und Laune ausgiebig spazieren gehen, den Rufen heimischer Vogelarten lauschen, auf den ausgewiesenen Liegewiesen chillen oder, gepflegt auf einer Bank sitzend, den Blick schweifen lassen.
Wer mit offenen Augen durch die Wuhlheide geht, wird einige ökologische Besonderheiten entdecken. Denn ihre biologische Vielfalt umfasst viele wertgebende Ökosysteme. Im Folgenden wollen wir Ihnen einige vorstellen.
Ein besonders geschützter Biotoptyp mit großer Tradition, vielen Bewohnern und heutzutage eine große Seltenheit ist der bodensaure Eichenwald, wie wir ihn auch in der Wuhlheide vorfinden. Diese lichten Eichenwälder sind auf trockene, nährstoffarme, sandige Bodenverhältnisse angewiesen und leben dort in trauter Verbundenheit mit einigen heute sehr seltenen, besonders geschützten Pflanzenarten, wie beispielsweise dem Weißblühenden Fingerkraut (Potentilla alba). Der Wald wird deshalb auch Fingerkraut-Eichenwald genannt. Das Vorkommen in der Wuhlheide zählt zu den größten im Nordosten Deutschlands.
Die heimischen Eichen (Stiel- und Traubeneiche) sind in unserer Flora die langlebigsten Baumarten, daher können sie stabile Lebensräume für weit über 1000 verschiedene Tierarten bilden. Insbesondere Insekten wie der streng geschützte Heldbock aus der Familie der Bockkäfer, die zu den größten Käfern Mitteleuropas zählen, fühlen sich hier heimisch.
Eher zu hören als zu sehen bekommt man einige der Vogelarten im Eichenwald. Da Alteichen gerne Großhöhlen ausbilden, bieten sie Obdach für die großen Spechtarten wie z.B. den Schwarzspecht und Eulen wie den Waldkauz.
Immense ökologische Bedeutung haben die unzähligen holzzersetzenden Pilzarten und Mikroorganismen, die vorzugsweise in und an alten bzw. geschädigten Bäumen leben.
Der Trocken- und Halbtrockenrasen ist ein europaweit besonders geschützter Biotoptyp, an den sich viele spezifische Arten der Flora und Fauna angepasst haben.
Silbergras, Grasnelke und Silberfingerkraut, Hasenklee, Schafsschwingel und Heidenelke pflegen hier ein schönes pflanzliches Miteinander. Dieses wiederum bildet den Lebensraum für Zauneidechsen, Sandlaufkäfer, die Blauflügelige Ödlandschrecke und andere Arten des typischen Berliner Sandtrockenrasens, wie er auch in der Wuhlheide, z. B. auf etwa 3 ha nördlich der Kastanienallee, vorkommt.
Zu den wesentlichen Standortfaktoren für einen stabilen Bestand von Trockenrasen zählen ein trockenwarmes Klima, direkte Sonneneinstrahlung und vor allem – Nährstoffarmut.
Nährstoffübersättigung, besonders infolge steigender atmogener Stickstoffeinträge, ist durch Landschaftspflegerische Maßnahmen (Mahd mit Entfernen des Mahdgutes) nur noch schwer zu begegnen. Dadurch gerät die Biodiversität der Trockenrasen leider zunehmend in Gefahr.
Zum Schutz der Hotspots des Naturschutzes, der vorhandenen Vielfalt von Lebensräumen und Arten, ist für Teilbereiche der Wuhlheide eine Unterschutzstellung als Natur- oder Landschaftsschutzgebiet geplant.
Kontakt
Parkmanagement „Wuhlheide erleben“
Straße zum FEZ 2
12459 Berlin
030-53071-505
kontakt@wuhlheide-erleben.de
Besucherinfo
Alles auf einen Blick
Sie möchten über die Wuhlheide auf dem Laufenden gehalten werden? Tragen Sie sich hier für den Newsletter ein und verpassen ab jetzt keine Neuigkeiten mehr.